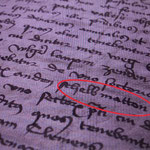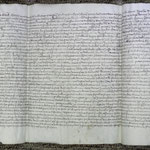Die Gebäude und ihre Zeit
Fingerabrücke der Zeit - in Holz
Von Werner Bellwald, Mai 2023
Wir sahen Gebäude und Jahreszahlen, wir sahen Landschaften und darin die Spuren der früheren Berglandwirtschaft. Damit wurde verständlich, welche Aufgabe die alten Bauten einst erfüllten. Doch was wissen wir von den Lebensumständen der damaligen Bewohner? Wer waren diese Leute, die hier vor 500, 600 oder 700 Jahren als Bauern in kleinen Häusern wohnten und ihr Getreide in die Stadel trugen? Wie sahen die politischen, die wirtschaftlichen, die gesellschaftlichen Verhältnisse aus? Und wann finden wir überhaupt die ersten Spuren menschlicher Anwesenheit im Gebiet von Zermatt?
Das Mattertal, auch Nikolaital genannt, ist eines der südlichen Walliser Seitentäler. Es beginnt unweit von Visp bei Stalden und umfasst talaufwärts die Gemeinden St. Niklaus, Randa und Täsch und als oberste Gemeinde Zermatt auf 1600 m ü. M. Heute zählt Zermatt um die 6000 Bewohner und 30'000 Gästebetten. Das 30 Kilometer lange Tal endet in der Gebirgsarena des Monte Rosa, des Matterhorns und weiterer Viertausender, von wo Pässe nach Süden und Westen führen. Die wichtigsten sind wohl der Theo- dulpass 3295 m ü. M. und der Col d'Hérens 3459 m ü. M. Diesen Übergängen kam zu verschiedenen Zeiten mehr als nur lokale Bedeutung zu.
Die frühesten menschlichen Spuren im Gebiet von Zermatt weisen auf eine sporadische Anwesenheit von Jägern und Sammlern: bei einem Felsunterstand auf der Alp Hermettji fanden Archäologen Spuren, die bis in die Zeit um 7'900 v. Chr. zurückreichen. Wir befinden uns im Mesolithikum, der Mittelsteinzeit (ca. 10'000–5'500 v. Chr.). Der Rastplatz unter dem Felsunterstand auf 2600 Metern Höhe wurde auch im Neolithikum besetzt (Jungsteinzeit, ca. 5'000–2'000 v. Chr.).
Eine sesshafte Bevölkerung ist erst für die letzten vorchristlichen Jahrhun- derte anzunehmen. Damals kam es in den Walliser Seitentälern erstmals zu einer ganzjährigen Besiedlung, wobei es sich um kleinere Bevölkerungsgruppen gehandelt haben dürfte. In bescheidenen Siedlungen wohnten im oberen Rhonetal Uberer, Angehörige eines keltischen Stammes. Aus dieser Zeit wurde in Zermatt bei Bauarbeiten am Hotel Monte Rosa 1868 und 1884 eine jungeisenzeitliche (letzte Jahrhunderte v. Christus) Töpferwerkstatt gefunden, eine ebensolche in den 1990er Jahren auf dem Furi (380–120 v. Chr.), die bis in römische und nachrömische Zeit betrieben wurde. Mit der Eroberung des Alpenraums um die Zeitenwende war auch das Wallis unter römische Herrschaft geraten; zahlreiche Münzfunde belegen die rege Benutzung des Theodulpasses in jener Epoche, in der die keltische Bevölkerung kulturell und sprachlich „romanisiert“ wurde.
Eine nächste, tiefgreifende Veränderung erfolgte knapp tausend Jahre später: Deutschsprachige Alemannen hatten seit dem 4. Jahrhundert den Rhein überschritten und Schritt für Schritt die heutige Deutschschweiz besiedelt. Um 700 war auch die Gegend des Thuner- und Brienzersees in ihrer Hand und sie begannen im 8. und 9. Jahrhundert, die Alpenpässe zu überschreiten und das Wallis zu kolonisieren. Um die Jahrtausendwende hatten sie das heutige Oberwallis zwischen der Furka und mindestens Raron/Steg besiedelt. Professor Iwar Werlen, der mit seinem Team das Orts- und Flurnamenbuch des Oberwallis vorbereitet, analysiert, dass die meisten Orts- und Flurnamen des Mattertales und auch der Umgebung von Zermatt deutsche Wurzeln aufweisen. Das zuvor eine Frühform des frankoprovenzalischen Dialektes sprechende Gebiet wurde im Zuge dieser alemannischen Landnahme deutsch. Vor allem besiedelten die Neuankömmlinge das Gebiet intensiver. Zahlreiche Einzelhöfe und viele kleine Weilersiedlungen überzogen nun Berg und Tal, es kam zu einem eigentlichen Kolonisierungsschub.
In dieser Zeit sind wir auch über die Herrschaftsverhältnisse unterrichtet. Politisch unterstand man in Zermatt dem Bischof von Sitten. Dieser war seit 999 nicht nur geistlicher, sondern auch weltlicher Landesherr des Wallis.
Begreiflicherweise nahm er die Verwaltungsaufgaben nicht selber wahr, sondern beauftragte dazu landauf landab seine Beamten. Diese zogen die Zehntabgaben ein, boten zum Kriegsdienst auf oder hielten beispielsweise Gericht. Im Tal von Zermatt war es ein Viztum, von der lateinischen Bezeichnung Vice-Dominus, modern gesagt ein Stellvertreter des Chefs, eben des Bischofs. Der Viztum übernahm Verwaltungsaufgaben, sorgte für Recht und Ordnung, war für Polizeiaufgaben und Steuern zuständig. Im 13. und 14. Jahrhundert nahmen die Grafen von Savoyen, aber auch Adelige wie das Haus Raron, die Asperlin, die Biandrate oder die Freiherren von Turn (mit ihrer grossen Stammburg bei Niedergesteln im Rhonetal) im Tal von Zermatt ihre Herrschaftsrechte wahr. In jener Epoche, im Jahr 1280, weiss man auch, dass Zermatt schon über einen eigenen Pfarrer verfügte. 1280 und 1285 wird Zermatt erstmals schriftlich als Pratobornum und als Pra Borno, 1350 als Praborgne und Praborny erwähnt. Der einstige Staatsarchivar Leo Meyer interpretierte den Namen als lateinische Form von Lochmatten (pratum = Wiese, Matte; borno = Mulde, Loch, Senke) – doch nennen Urkunden, Literatur und mündliche Überlieferung nie eine Lochmatte; Praborno beziehungsweise Pratobornum wird heute als Wiese mit zahlreichen Wassern (Quellen) oder Matte in einem Quellgebiet gedeutet, was für die Ebene und die ringsum zufliessenden Bäche auch zutrifft.
Als die Macht des Adelshauses von Turn in den 1370er Jahren gebrochen wurde, übten andere Walliser Adelsfamilien im Tal von Zermatt die Justiz und die Verwaltung aus: die Adelsfamilie der von Raron und die Esperlin, ebenfalls aus Raron. Doch wie an den meisten Orten im Verlauf des Spätmittelalters, verloren die adeligen Familien auch hier ihre Positionen. Einheimische Führungsfamilien nahmen ihnen die Macht ab. Schon 1365 verkaufte die Adelsfamilie der Biandrate (Visp) ihre Rechte über Zermatt an die Familie de Platea; 1515 veräusserten die Esperlin ihre Rechte über 115 Haushaltungen an die de Werra. Von diesen sogenannten Patriotenfamilien wiederum begannen sich die Zermatter nach 1500 Schritt für Schritt loszukaufen: 1538 von den de Werra in Leuk, 1562 von den Perrini in Leuk, 1618 von den de Platea in Visp. Zu Beginn dieser Epoche wird Zermatt auch erstmals in deutscher Sprache schriftlich fassbar und heisst 1495 Zer Matt – zur Matte: Tatsächlich liegt die Siedlung mitten im schroffen Bergtal auf einer ausgedehnten Wiesenfläche, im Dialekt ,Matte’ genannt.
Im Spätmittelalter geschieht etwas Weiteres, was unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht: Eine Auswanderung aus Zermatt, die sich in den Jahrzehnten zwischen 1400 und 1450 in grösserem Umfang in den Archiven belegen lässt. Der nach Westen führende Col d'Hérens erschliesst den Zermattern ihre Auswanderungsziele: erstens im Eringtal die Siedlungen auf dem heutigen Gemeindeterritorium von Evolène und von St-Martin, zweitens am Talausgang die Stadt Sitten und ihre umliegenden Dörfer, vor allem Bramois (deutsch: Brämis), aber auch die südexponierte, rechtsufrige Talflanke des Rhonetals oberhalb Sitten. Die Auswanderung muss zahlenmässig bedeutend gewesen sein: Um 1500 ist etwa ein Drittel der Bevölkerung Evolènes und Saint Martins deutschsprachig.
Die Gründe für diese Auswanderung sind nur zu vermuten. Auffallend ist, dass eine eigentliche Auswanderungswelle in Richtung Mittelwallis in die Zeit merklicher Klimaverschlechterung fällt. Denkbar ist folgende Erklärung: Sowohl im Zeitraum 1120–1190 als auch zwischen ca. 1350 und 1400 weisen die Zermatter Werte auf eine Klimagunst, die teils mit dem allgemeinen hochmittelalterlichen Klimaoptimum übereinstimmen. Das Getreide gedieh auch in den obersten Regionen, die Gletscher hatten sich mindestens auf den heutigen Stand zurückgezogen, die Bauern lebten und wirtschafteten in Höhenlagen, die heute über der Grenze des Machbaren liegen. Zwar war die Klimagunst nach 1200 ein erstes Mal für die Dauer einer Generation eingebrochen. Die Zeit 1400–1450 brachte einen zweiten, schon härteren klimatischen Dämpfer: Seit den 1390er Jahren begannen die Jahresdurchschnittstemperaturen zu sinken. Sie fielen weiter und sollten sich erst nach 1450 langsam wieder erholen – ein Vorgeschmack auf das, was später als Kleine Eiszeit in die Geschichte eingehen sollte. 1665 sollten die Zermatter schreiben, ihre Pfarrei sei „montibus et glaciebus perpetuis simul et collibus nivibus onustis circumdata“ - von Bergen und zugleich ewigen Gletschern und schneebeladenen Höhen umgeben.
Genau für diese Jahre nach 1400 beobachtete der Historiker Hans-Robert Ammann, der sich intensiv mit der spätmittelalterlichen Zermatter Emigration beschäftigte, in den Notariatsakten zahlreiche Immobiliengeschäfte ausgewanderter Zermatter. Deren Zunahme seit den 1420er Jahren und eine Massierung in den 1430er und 1440er Jahren fallen zusammen mit dem für Zermatt und einem allgemein feststellbaren Klimatief. Offenbar war der Talkessel von Zermatt in den Generationen zuvor stark besiedelt und viele Gebiete urbar gemacht worden. Dank dem guten Klima konnte man viele Köpfe ernähren, die Bevölkerung war angewachsen.
Auch Hans-Robert Ammann sieht in dieser demografischen Entwicklung einen der Hauptgründe der Emigration, wohl in Kombination mit den klimatischen Verhältnissen und allenfalls persönlichen Motiven. Ammann nennt das Beispiel von 12 Zermattern, die 1412–1427 Sittener Bürger wurden und von denen drei Kaufleute waren, die sich wohl aus kommerziellen Interessen in der Hauptstadt niederliessen. Politische Gründe schliesst Ammann eher aus und analysiert, dass der Steuerdruck im Tal von Zermatt kein überdurchschnittlich hoher gewesen sei. Auch der Übergang der Rechte von den Adels- an die Patriotenfamilien dürfte hier keinen direkten Einfluss auf das Migrationsverhalten ausgeübt haben.
Einen Rückschluss auf die Grössenordnung der Auswanderung erlaubt die räumliche Organisation der Zermatter Familien im Jahr 1476. In der bereits erwähnten Urkunde werden 182 Familien, beziehungsweise Haushaltungen, aufgezählt, also einige Hundert Bewohnerinnen und Bewohner – Leo Meyer spricht von 782 Personen. Auch eine neuere Schätzung durch Hans-Robert Ammann tendiert zu einer ähnlichen Grössenordnung, indem er die 182 Familien mit Koeffizient 3 oder 4 multipliziert, was 543 oder 724 Bewohner ergäbe, die nach der Auswanderungswelle immer noch in Zermatt wohnhaft waren.
Kehren wir zurück zu den politischen Verhältnissen. Die Zermatter hatten sich inzwischen selbstständig zu organisieren begonnen. Im Wallis werden seit dem 13. Jahrhundert immer mehr genossenschaftliche Gründungen fassbar, mit denen sich die Bauern an den jeweiligen Orten zusammenschlossen. Sie regelten nicht nur die Bewirtschaftungsweisen und die Rechte und Pflichten. Aus diesen Korporationen erwuchs auch eine politische Kraft, die zur Bildung von Gemeinden führte. Spätestens im 16. und 17. Jahrhundert kaufte man sich von den letzten jährlichen Steuerabgaben los und wurde selbständig. Stolz baute man prächtige Gemeindehäuser.
Diejenigen Zermatter Familien, die sich am frühesten (1538) von den Abgaben loskauften, gaben sich 1540 gemeinsame Statuten und schlossen sich zu einer Gemeinde zusammen. Ihnen folgten 1562 und 1618 weitere Familien, die sich losgekauft hatten und nun einen eigenen Gemeinde- verband gründeten (Statuten 1576 und 1621). Aus den drei Loskäufen gingen drei unabhängige Gemeinden hervor. Jede gab sich eine Verfassung, funktionierte als freies Meiertum und wählte selbständig einen Meier. Er stammte aus den Reihen der Einheimischen, blieb jeweils zwei Jahre im Amt, war Richter und Vorsteher und er oder sein Statthalter konnten Zermatt im Landrat vertreten, modern gesagt, in der Kantonsregierung der Republik Wallis. Erst 1791 schlossen sich die bisherigen Gemeinden und Viertel zu einer einzigen Gemeinde zusammen. Wir haben hier eine Art „Kleinfusion“ vor uns, wie sie in der Zeit zwischen 1700 und 1800 hie und da im Wallis vorkommen und die bis ins 20. Jahrhundert bleibenden Gemeindegebiete bilden. Noch 1798, damals zählte Zermatt etwas über 400 Bewohner, gab es rund um das Dorf elf bewohnte Weiler. Es sind die Weiler Zur Matt, Mutt, Furi, Blatten, Bächen, Findelen, Winkelmatten, Steinmatten, Ried, Howeten und zem Biel (erstaunlicherweise fehlt zem See, das vielleicht bei Furi mitgerechnet wurde). Hundert Jahre später, 1892, zählte man immer noch sieben bewohnte Weiler.
Die neuere Geschichte Zermatts streifen wir nur kurz und erinnern an den Bau der ersten Herberge, die 1838 durch den Arzt J. Lauber eingerichtet wurde und 1839 bei der Eröffnung lediglich drei Betten zählte. Erst 1850 kam der „Hotelkönig“ Alexander Seiler nach Zermatt, 1852 wurde das Hotel Mont Cervin eröffnet, das sogenannte Golden Age des Alpinismus brach an. Mit der Besteigung des Matterhorns und dem dramatischen Unglück beim Abstieg wurde das Matterhorn 1865 ein international berühmter Berg und Zermatt in der Folge weltweit bekannt. Das Dörflein wuchs zur kleinen Stadt heran und verleibte sich die nahen Weiler ein. Als eigene Siedlungen blieben bis auf den heutigen Tag die Weiler Blatten, Zum See, Furi, Findeln, Zmutt und Ried. Hier blieben mehrere altertümlich anmutende Gebäude erhalten, deren Alter jedoch mangels Inschriften und Jahreszahlen bisher unbekannt war. Nun datiert die Analyse der Holzjahrringe sie überraschend ins Spätmittelalter. Die Gebäude zwischen Zermatt und Zmutt und im Aroleyt aus der Zeit des 13. bis 16. Jahrhunderts sind hier nun erstmals publiziert. Weitere Kulturwege sollen in Zukunft auch die anderen Weiler mit ihrer wertvollen Bausubstanz der Öffentlichkeit bekannt machen und damit einen wichtigen Beitrag leisten zu einem bisher wenig erforschten Aspekt der Zermatter und der Walliser Geschichte.

Was pflanzten die Bauern, wovon lebten die Familien? Zermatt kauft sich 1570 von allen verbleibenden Zehnten los, darunter der Winterzehnten und der Langsizehnten („Lanxi“ = Frühling), wobei namentlich Roggen, Hafer, Weizen, Erbsen (rot markiert: erbis), Bohnen (blau markiert: bonen), Gerste und Werk aufgeführt werden (Pfarrarchiv Zermatt, Signatur N6, Pergament vom 8. Februar 1570, Ausschnitt).